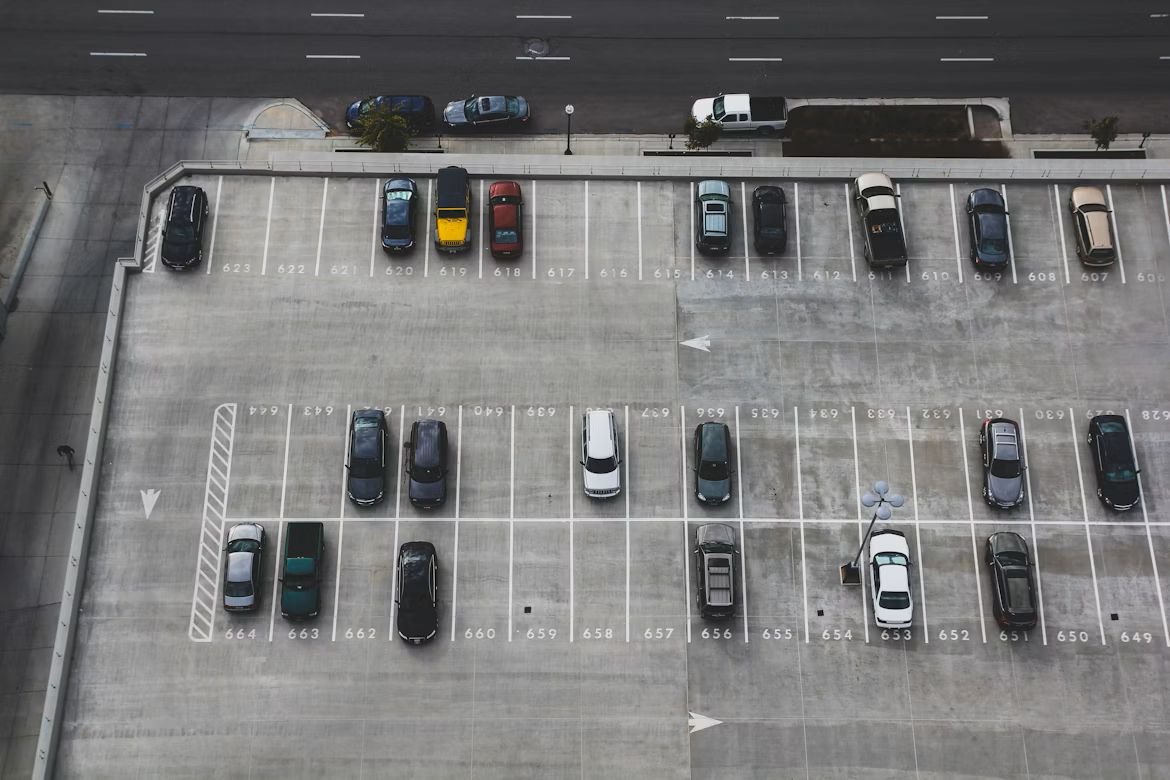Der Moment der Rückkehr aus dem Urlaub oder von einer Geschäftsreise sollte von Vorfreude geprägt sein. Das Gepäck ist schnell vom Band geholt, der Weg zum vereinbarten Treffpunkt ist zügig erledigt. Dort wartet, wie gebucht, ein Mitarbeiter des Valet-Park-Services mit dem eigenen Fahrzeug. Ein bequemer Luxus, der den Reisestress minimieren soll. Doch dann der Schock: Eine lange Schramme zieht sich über die Beifahrertür, die vorher definitiv nicht da war. Der Stoßfänger weist eine Delle auf, die auf einen unachtsamen Parkrempler hindeutet. Die anfängliche Entspannung weicht Ärger und Unsicherheit. Wer kommt für diesen Schaden auf? Was sind die eigenen Rechte? Das erfahren Sie in diesem Artikel.
Die Wahl des Anbieters: Parkos als positives Beispiel
Die Übergabe des eigenen Autoschlüssels ist ein erheblicher Vertrauensbeweis. Man legt ein Vermögensobjekt in fremde Hände und erwartet einen professionellen und sorgsamen Umgang. Umso wichtiger ist es, die Auswahl des Parkdienstleisters nicht allein vom Preis abhängig zu machen. Der Markt für flughafennahes Parken ist groß und unübersichtlich. Vergleichsportale können hier eine erste Orientierung bieten, um Angebote zu filtern und Dienstleister zu finden.
Eine solche Plattform ist beispielsweise Parkos. Auf parkos.de lassen sich verschiedene Anbieter für Valet- und Shuttle-Parken an zahlreichen Flughäfen vergleichen. Der Vorteil solcher Portale liegt in der Bündelung von Informationen und der Möglichkeit, auf Nutzerbewertungen zurückzugreifen. Zufriedene Kunden von Parkos berichten oft von reibungslosen Abläufen und vor allem von einem gut erreichbaren und hilfsbereiten Support, der auch bei Problemen lösungsorientiert zur Seite steht. Dies wird zum entscheidenden Faktor, wenn eben nicht alles nach Plan verläuft. Man sollte bei der Buchung darauf achten, dass der Anbieter detaillierte Informationen zu seinen Versicherungspolicen bereitstellt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen verständlich und fair gestaltet sind.
Zwischen Verwahrung und Miete: Die rechtliche Einordnung des Parkservices
Um die eigenen Rechte zu verstehen, ist ein Blick auf die rechtliche Grundlage des Vertragsverhältnisses mit dem Valet-Service unerlässlich. Juristisch gesehen kommen hier hauptsächlich zwei Vertragstypen in Betracht: der Mietvertrag nach § 535 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) oder der Verwahrungsvertrag nach § 688 BGB.
Ein reiner Mietvertrag liegt meist dann vor, wenn man lediglich einen bestimmten oder unbestimmten Parkplatz anmietet und das Fahrzeug selbst abstellt und wieder abholt (Shuttle-Parken). Die Hauptpflicht des Anbieters ist hier die Überlassung des Parkraums. Die Obhutspflichten sind hier geringer.
Beim Valet-Parken hingegen, bei dem der Fahrzeugschlüssel übergeben wird und der Anbieter das Fahrzeug an einen nicht immer bekannten Ort verbringt und dort parkt, liegt in der Regel ein Verwahrungsvertrag vor. Der entscheidende Unterschied ist die Übernahme der Obhut. Der Dienstleister verpflichtet sich, auf das Fahrzeug aufzupassen und es vor Schäden zu bewahren. Diese erhöhte Sorgfaltspflicht ist die Grundlage für weitergehende Haftungsansprüche. Aus dieser Hauptpflicht ergeben sich zahlreiche Nebenpflichten, wie beispielsweise das sichere Abstellen des Fahrzeugs, der Schutz vor Diebstahl und der sorgsame Umgang beim Rangieren.
Die Haftungsfrage: Wer zahlt für den Schaden?
Die zentrale Frage für Betroffene lautet: Haftet der Parkservice für den entstandenen Schaden? Die Antwort lautet im Grundsatz: Ja. Nach § 280 BGB macht sich schadensersatzpflichtig, wer eine Pflicht aus einem Schuldverhältnis verletzt. Beim Verwahrungsvertrag ist die Pflicht zur sorgsamen Obhut eine solche zentrale Pflicht.
Besonders relevant ist hierbei die Regelung des § 278 BGB. Dieser Paragraph besagt, dass ein Schuldner – in diesem Fall der Parkservice-Betreiber – das Verschulden seiner Mitarbeiter oder anderer Personen, die er zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit einsetzt, in gleichem Umfang zu vertreten hat wie eigenes Verschulden. Diese Personen werden als „Erfüllungsgehilfen“ bezeichnet. Verursacht also der Fahrer, der das Auto in das Parkhaus fährt, durch Unachtsamkeit einen Kratzer, wird dieses Verschulden direkt dem Unternehmen zugerechnet. Der Betreiber kann sich nicht damit herausreden, er habe seinen Mitarbeiter sorgfältig ausgewählt und angewiesen. Diese sogenannte Zurechnungsnorm ist ein starkes Recht für den geschädigten Kunden.
Die Haftung umfasst dabei nicht nur Schäden, die beim direkten Rangieren oder Parken entstehen. Sie erstreckt sich auf den gesamten Zeitraum, in dem sich das Fahrzeug in der Obhut des Dienstleisters befindet. Das schließt beispielsweise auch Schäden durch unzureichende Sicherung auf dem Parkgelände mit ein, etwa wenn Bauteile von einer Decke herabfallen oder das Fahrzeug auf einem unsicheren Untergrund abgestellt wird.
Das A und O bei Schadensentdeckung: Sofort handeln und dokumentieren
Ist der Schaden einmal entdeckt, ist schnelles und systematisches Handeln gefragt. Die ersten Minuten entscheiden oft über den Erfolg einer späteren Schadensregulierung. Jede Zögerlichkeit kann später als Nachteil ausgelegt werden.
Der allererste und wichtigste Schritt ist, den Schaden sofort und noch vor Ort in Anwesenheit des Mitarbeiters, der das Fahrzeug übergeben hat, zu rügen. Man sollte das Fahrzeug unter keinen Umständen einfach in Empfang nehmen und wegfahren, um den Schaden später von zu Hause aus zu melden. Ein solches Verhalten kann rechtlich als stillschweigende Abnahme des Fahrzeugs in vertragsgemäßem Zustand gewertet werden, was die spätere Beweisführung erheblich erschwert.
Man sollte den Mitarbeiter des Parkservices unmissverständlich auf die neu entstandenen Schäden hinweisen. Dessen Reaktion – ob abwehrend oder kooperativ – sollte man sich gut einprägen und gegebenenfalls Notizen dazu machen. Parallel dazu ist eine lückenlose Dokumentation unerlässlich. Man sollte mit dem Smartphone aus verschiedenen Perspektiven und Distanzen aussagekräftige Fotos anfertigen. Detailaufnahmen der Kratzer oder Dellen sind genauso wichtig wie Übersichtsaufnahmen, die das gesamte Fahrzeug und die Umgebung zeigen. Ein kurzes Video, das den Schaden umrundet, kann ebenfalls hilfreich sein.
Man sollte darauf bestehen, ein Schadensprotokoll anzufertigen. Seriöse Anbieter halten dafür Formulare bereit. In diesem Protokoll müssen alle Schäden detailliert aufgelistet werden. Wichtig ist, dass der Mitarbeiter des Dienstleisters dieses Protokoll ebenfalls unterzeichnet. Weigert er sich, sollte man dies im Protokoll vermerken und idealerweise einen unbeteiligten Zeugen (z.B. einen Mitreisenden oder eine andere Person am Terminal) hinzuziehen, der die Situation und den Schaden bestätigen und das Protokoll ebenfalls unterzeichnen kann.
Die Tücken der Beweislast: Wie man seine Ansprüche untermauert
Im deutschen Zivilrecht gilt der Grundsatz, dass derjenige, der einen Anspruch geltend macht, die anspruchsbegründenden Tatsachen beweisen muss. Das bedeutet für den geschädigten Fahrzeughalter: Er muss beweisen, dass sein Auto vor der Übergabe an den Parkservice unversehrt war und bei der Rückgabe den neuen Schaden aufwies.
Dieser Nachweis kann in der Praxis schwierig sein. Wer macht schon vor jeder Abgabe seines Autos ein komplettes Foto- oder Videoprotokoll? Dennoch ist dies die sicherste Methode. Es empfiehlt sich dringend, vor der Übergabe des Schlüssels einmal mit dem Smartphone um das eigene Auto zu gehen und den Zustand kurz zu dokumentieren. Besonders Felgen, Stoßfänger und Türen sollte man dabei im Blick haben. Liegt ein solches „Vorher-Video“ vor, ist die Beweisführung ungleich einfacher.
Doch auch ohne eine solche lückenlose Dokumentation ist die Lage nicht hoffnungslos. Gerichte neigen in Fällen, in denen ein Schaden innerhalb der Obhutszeit eines Dienstleisters entsteht, zu Beweiserleichterungen bis hin zu einer Beweislastumkehr. Wenn der Kunde glaubhaft machen kann, dass der Schaden höchstwahrscheinlich während der Parkdauer entstanden ist – weil er zum Beispiel direkt von einer langen Fahrt kommt und das Auto bis zur Übergabe nicht aus den Augen gelassen hat –, muss oft der Parkservice beweisen, dass er den Schaden nicht verursacht hat. Dies ist für den Anbieter meist nur schwer möglich, wie auch ein Urteil des Oberlandesgerichts Köln (Az. 22 U 134/17) zeigt, bei dem ein Hotel für Reifenschäden haftbar gemacht wurde, die durch einen Mitarbeiter des Parkservices verursacht wurden.
Kleingedrucktes mit großer Wirkung: Was in den AGB stehen darf – und was nicht
Jeder Parkservice verwendet Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB). Oft wird versucht, die Haftung in diesem Kleingedruckten so weit wie möglich zu beschränken oder ganz auszuschließen. Klauseln wie „Für Schäden am Fahrzeug wird keine Haftung übernommen“ sind an der Tagesordnung.
Allerdings sind solche pauschalen Haftungsausschlüsse in aller Regel unwirksam. Das Gesetz, insbesondere die §§ 307 ff. BGB, setzt solchen Klauseln enge Grenzen. Eine Haftung für Schäden, die auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Unternehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen, kann niemals ausgeschlossen werden. Ebenso unwirksam sind Klauseln, die die Haftung für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ausschließen. Die Pflicht, das übergebene Fahrzeug unbeschädigt zurückzugeben, ist eine solche wesentliche Pflicht.
Dennoch sollte man sich nicht blind auf die Unwirksamkeit von AGB-Klauseln verlassen. Manchmal werden Haftungsbeschränkungen für leichte Fahrlässigkeit oder für bestimmte Schadensarten (z.B. für im Auto gelassene Wertsachen) wirksam vereinbart. Eine genaue Prüfung der AGB vor Vertragsabschluss ist daher immer ratsam. Lässt sich ein Anbieter auf keine Diskussion über den Schaden ein und verweist stur auf seine AGB, ist oft der Gang zu einem auf Verkehrsrecht spezialisierten Rechtsanwalt der nächste logische Schritt. Dieser kann die Rechtslage prüfen und den Druck auf den Anbieter oder dessen Versicherung erhöhen, um den Schaden zu regulieren.
Lesen Sie auch: Gut zu wissen: In diesen Fällen kann ein Auto-Kran helfen.