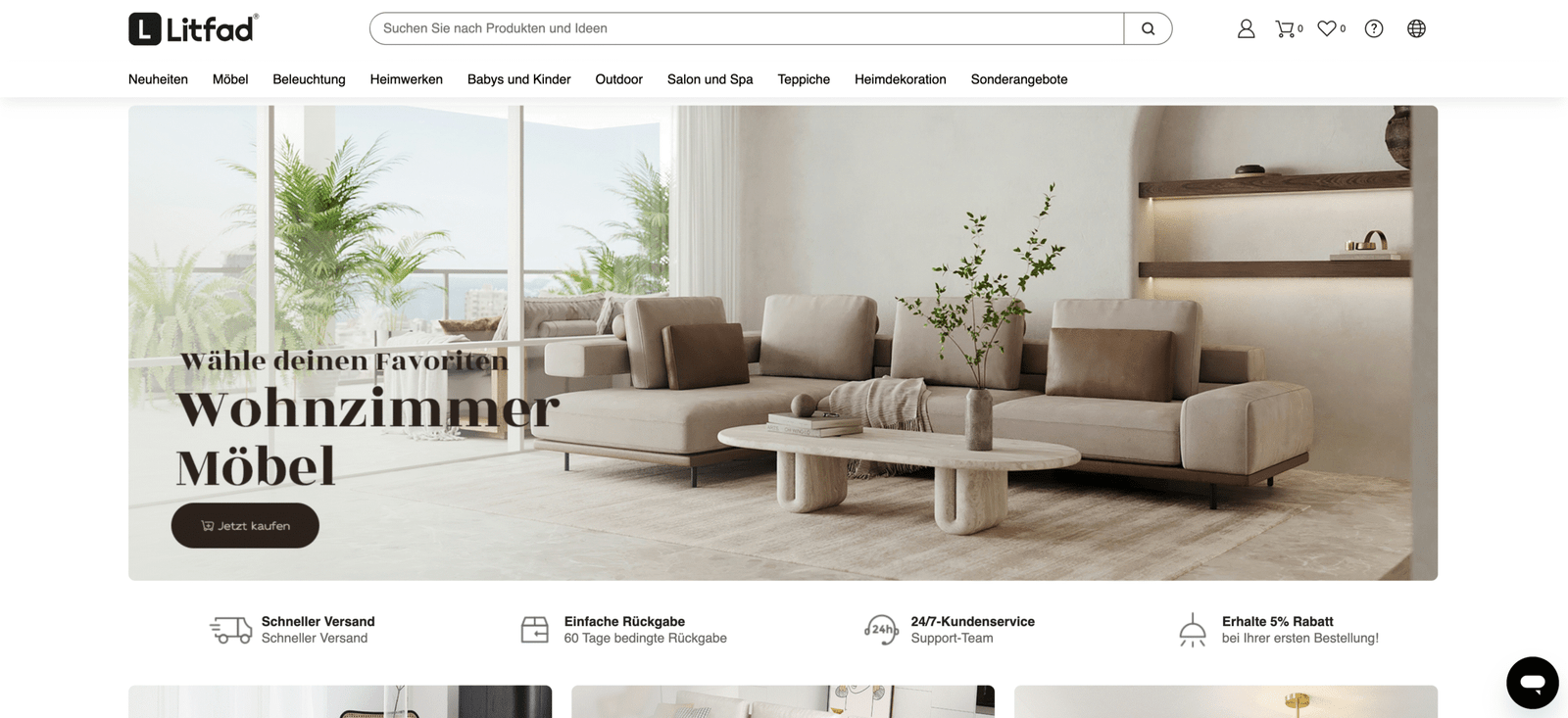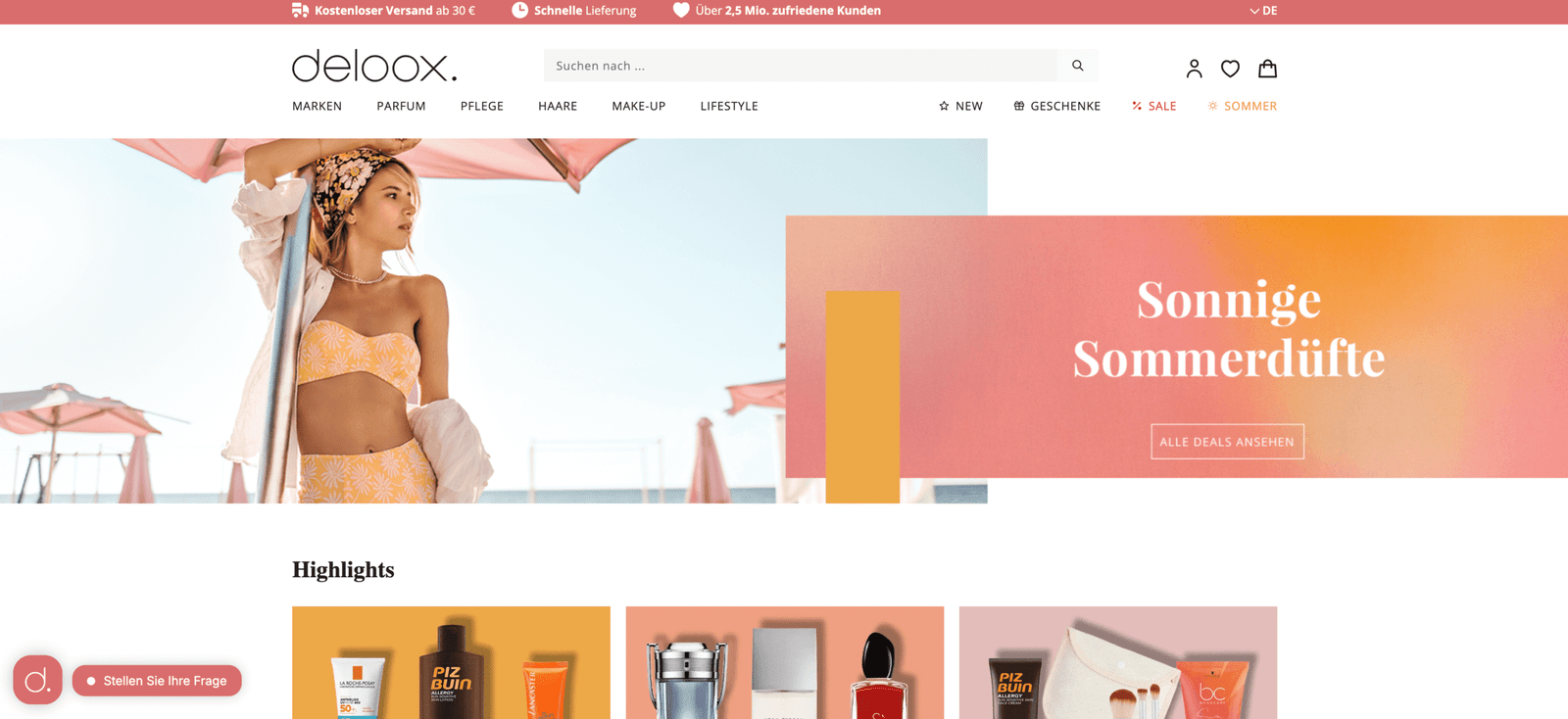Die eigenen Daten sind etwas, mit dem heute viele Menschen freizügig umgehen. Leider viel zu freizügig, denn im Netz sind diese, egal wie belanglos sie erscheinen mögen, Gold wert.
„Welches dieser Handys besitzen Sie?“ fragt YouTube, bevor wir ein Video anschauen können. Weil es als harmlose Frage erscheint, wählen wir eines der Kästchen aus. Einmal mehr haben wir damit etwas von uns preisgegeben. Der Fragesteller weiß nun, dass ein Benutzer mit der IP-Adresse XYZ aus Ort XY beispielsweise ein iPhone X besitzt. Kann er ruhig wissen, denken Sie? Dann sollten Sie folgenden Artikel genau lesen. Denn er zeigt, warum Datengeiz heute enorm notwendig ist.
- Weil das Netz nie vergisst
Tatsache ist: Es gibt, erst recht, seitdem die DSGVO in Kraft trat, ein „Recht auf Vergessenwerden“ für alle Daten, von denen man nicht möchte, dass diese im Netz verbleiben. Tatsache ist aber auch, dieses Gesetz hat diverse Lücken. Es ist ebenso eine Tatsache, dass selbst das Recht aufgrund der Struktur des Internets vielfach schlicht kapitulieren muss. Natürlich kann man ein Bild, auf dem man in einer nicht vorzeigbaren Situation ist, löschen oder den Seitenbetreiber auffordern, dies zu tun. Dann ist es zumindest von der Plattform verschwunden.
Doch bis das passiert, braucht es nur einen Fingertipp auf die „Drucken“-Taste, um einen Screenshot zu erzeugen. Einen Klick mit der rechten Maustaste und dann „Grafik speichern unter…“ und das Bild landet auf einem privaten Rechner, einem privaten Smartphone. Selbst wenn all das nicht eintritt, gibt es immer noch Internet-Archive wie die Wayback-Machine, welche es ermöglichen, alte Versionen einer Webseite zu sehen. Selbst wenn die Seite gar nicht mehr existiert. Bevor dort etwas gelöscht wird, muss ein weiterer Antrag gestellt werden.
Was einmal im Netz landet, bleibt mit höchster Wahrscheinlichkeit für immer dort. Vielleicht nicht an prominenter Stelle, vielleicht nicht mal im Netz, sondern auf irgendeinem Server oder Privatrechnern. Aber man muss immer damit rechnen, dass niemals etwas vollständig zurückgeholt werden kann.

Bei jeder Peinlichkeit, die auch nur für Sekunden im Netz war, muss man damit rechnen, dass sie dort für immer verbleibt. Fotolia.com © Jürgen Fälchle
- Weil man damit zahlt
„Womit verdient Facebook eigentlich Geld?“ Diese Frage scheinen viele Normalsterbliche nur mit einem Schulterzucken beantworten zu können. Googelt man sie, bekommt man allein fast 400.000 deutschsprachige Suchergebnisse. Die Antwort ist lapidar und erschreckend: „Mit den Daten seiner Benutzer, indem diese für höchstpersonalisierte Werbung verkauft werden“. Auf gut Deutsch: absolut alles, was man auf sozialen Netzen, ja, im ganzen Netz von sich preisgibt, ist zu einem enorm wertvollen Zahlungsmittel geworden.
Jedes einzelne „Like“, jede Angabe zu Ausbildung, zu Arbeitgeber, den eigenen Freunden, jede Markierung, Beziehungsstatus, kurz „alles“, was man an Daten zur Verfügung stellt und sei es nur, wann und wie lange man auf der Seite verweilt, nutzt Facebook (wie die meisten anderen Social-Media-Netzwerke), um über Algorithmen höchstpräzise Nutzerprofile zu erstellen, die einen Mensch gegenüber dem Seitenbetreiber so gläsern machen, wie es nur möglich ist. Diese Daten werden an Unternehmen verkauft, welche sie benutzen, um zielgerichtet Werbung zu schalten. Die maximale Personalisierung hält die Streuverluste und Kosten in Grenzen. Und das Perfide: Selbst, wenn man gar nichts aktiv von sich preisgibt, tun das die Geräte, über die man die Plattformen nutzt, noch im Hintergrund.
Doch nicht nur Facebook ist der Schuldige. Noch jeder Internetshop fragt überflüssige personenbezogene Daten ab und misst, wie lange man auf welcher Produktseite verweilt und zeigt einem, anhand vorheriger Käufe, zielgerichtet Dinge, die einen interessieren könnten.

Es ist geheimdienstliches Grund-Business, jenseits der Gesetze fremder Länder zu operieren. Daher haben Datenschutzgesetze enge praktische Grenzen.
Fotolia.com © corepics
- Weil Gesetze oft nichts nützen
NSA, GCHQ, Tempora, Cambridge Analytica. Hinter jedem dieser Begriffe steht der schlagende Beweis dafür, dass im Netz nichts und niemand sicher sind. Viel mehr noch: Es gibt keine „uninteressanten“ Daten. Natürlich, abermals kann man hier Datenschutzbestimmungen ins Feld führen, welche mittlerweile in den meisten Ländern implementiert wurden. Man kann auch noch anführen, dass die EU, was das anbelangt, es wirklich ernst meint.
Doch man muss dabei auch zugeben, dass die kompliziertesten Gesetze im Zweifelsfall nur Schall und Rauch sind, wenn Kriminelle und/oder staatliche Akteure sie ignorieren. Natürlich ist es verboten, den E-Mail-Verkehr eines Großteils der Welt-Internetbevölkerung zu durchleuchten. Hat es die NSA gehindert, es trotzdem zu tun? Dank Edward Snowden wissen wir, nein. Man darf getrost davon ausgehen, dass jetzt, in dieser Sekunde, eine weitere Operation daran arbeitet, die Welt-Datenströme im Geheimen zu durchkämmen. Ausreden gibt es schließlich genug, im Zweifelsfall „Kampf gegen den Terror“.
Um es ganz einfach zu erklären: Sobald man sich im Netz bewegt. Sobald man auch nur ein Gerät benutzt, das irgendwie mit dem Netz verbunden ist, muss man damit rechnen, dass darüber Daten in die falschen Hände geraten. Viele wissen das und begegnen dieser Tatsache mit einem schulterzuckenden „ich habe nichts zu verbergen“. Doch sollte man sich, wenn man zu dieser Kategorie gehört, selbst die Frage stellen: Würde man mit der gleichen Ausrede auch in einem gläsernen Haus mit gläsernen Innenwänden ohne Vorhänge und mit unverschlossenen Türen leben wollen? Weil man ja nichts zu verbergen hat und es Gesetze gegen Einbrecher und Stalking gibt? Das ist kein trivialer Vergleich, es ist das vollkommen gleiche Prinzip.
- Weil Geräte und Software unkontrollierbar sind
Ein Witz für den Stammtisch: Militärs geben richtig viel Steuergeld dafür aus, dass ihre Installationen geheim bleiben. Straßenschilder „Geheime Abhörbasis, nächste Ausfahrt rechts“ gibt es keine. Auf den öffentlich zugänglichen Luftbildportalen wie Google Maps wird aus dem gleichen Grund verpixelt, was das Zeug hält. Die Pointe: Plötzlich tauchen dann wie von Geisterhand Spuren im Netz auf. Erzeugt von einer Fitness-App, welche auf den Smartphones läuft, die die Solldaten beim Training in der Tasche haben und die dem App-Betreiber in brillanter Auflösung nicht nur die Lage geheimster Objekte verrät, sondern nebenbei auch noch, wer da arbeitet.
Leider ein Witz mit realem Hintergrund. Denn gleich zweimal in diesem Jahr wurde bekannt, dass genau das passiert ist. Es ist ein Beispiel, dem leider viel zu wenige Menschen Gehör schenken. Denn die Geräte und Programme, die wir nutzen, sind alles andere als transparent. Das gilt nochmals so stark, wenn es sich um Mobilgeräte handelt. Denn Apps sind, was Datenschutz anbelangt, wesentlich problematisch als der Besuch einer Webseite. Es beginnt bei „Gratis“-Apps damit, dass da nichts gratis ist, sondern man, wie in Punkt 2 erklärt, durch die Bereitstellung seiner personenbezogenen Daten zahlt. Das Problem entsteht dadurch, dass sich viele Nutzer nicht bewusst sind, dass Apps nichts anderes als kleine Software-Programme sind. Sie können viel umfangreichere Berechtigungen einfordern.
Nur mal als Beispiel: Man möchte via Handy auf der Seite eines großen Webshops einkaufen. Geht man dazu klassisch über den Browser, bekommt der Webshop natürlich nur die Daten, auf die der Handybrowser Zugriffsberechtigung hat. Nutzt man jedoch die App des Shops, kann diese sehr viel mehr Berechtigungen einfordern, dass die wenigsten sich dafür interessieren, dass diese Berechtigungen in den meisten App-Shops vor dem Download angezeigt werden, ist da noch die Krönung.
So kommt es, dass in den Taschen von aktuell 81 Prozent aller Deutschen und 66 Prozent der Weltbevölkerung Geräte arbeiten, die über eine unglaublich vielfältige Sensorik verfügen. Die Lage und Bewegung ebenso erfassen können wie den metergenauen Standort. Geräte, welche hochempfindliche Mikrofone besitzen, die Daten von unzähligen weiteren Kontakten und die so kompakt und verbreitet sind, dass sie absolut unauffällig sind. Genau darauf stecken Programme von unzähligen gesichtslosen Firmen, bei denen der Benutzer auch noch zugestimmt hat, dass diese Tools auf die Sensorik zugreifen dürfen, des Komforts wegen. Ein Szenario, welches auch Orwell nicht hätte ersinnen können. Schon weil so viele Menschen freiwillig diese Dauerüberwachung mitmachen.